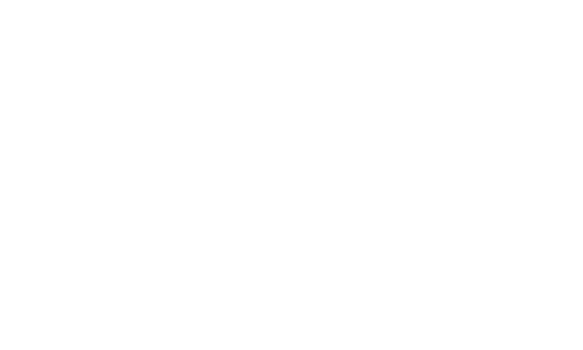Schlafstörungen

Jeder von uns kennt schlaflose Nächte – vor einer Prüfung, aufgrund eines Streites oder belastender Alltagsprobleme bereitet es uns Schwierigkeiten, ein- und/oder durchzuschlafen. Wir liegen wach im Bett, oft grübeln wir und drehen uns von einer auf die andere Seite. Passiert dies nur gelegentlich, ist es noch kein Grund zur Sorge.
Bleiben die Ein- und Durchschlafstörungen aber über einen längeren Zeitraum bestehen, so kann es sich um eine krankheitswertige Schlafstörung handeln, die behandelt werden sollte.
Häufig tritt eine nichtorganische Schlafstörung als Reaktion auf ein belastendes Ereignis (Trennung, Todesfall, Jobverlust, Beziehungsprobleme etc.) auf. Viele Betroffene haben Schwierigkeiten, vom Alltag abzuschalten und grübeln viel. Dadurch wird Ein- und Durchschlafen erschwert oder verunmöglicht. Mit Fortbestehen der Schlafstörung kann es passieren, dass Betroffene selbst dann nicht mehr schlafen können, wenn der Vortag entspannt und stressfrei verlaufen ist. Oft entwickelt sich eine Angst davor, nicht schlafen zu können. Diese verunmöglicht wiederum das Einschlafen – ein Teufelskreis beginnt. Das Bett hört dann auf, ein angenehmer Ort zu sein, den man mit Entspannung verknüpft, und wird zu einem Ort, den man mit seinen nächtlichen Qualen in Verbindung bringt. Dadurch bleibt die Schlafstörung aufrecht.
Aufgrund negativer Vorerfahrungen werden vor dem Schlafengehen negative Erwartungen erneut aktiviert („Ich werde nicht schlafen können“, „Es wird wieder eine furchtbare Nacht“ etc.). Diese negativen Erwartungen und Gedanken führen zu einer Verstärkung der Schlafstörung.
Im Rahmen der psychologischen Behandlung der Schlafstörung wird ein individuelles Erklärungsmodell erstellt, wie es zur Entwicklung der Schlafstörung gekommen ist. Dieses berücksichtigt Risikofaktoren (z. B. ungesunder Lebensstil, zu hohes Leistungsbedürfnis, ...) ebenso wie Auslöser (z. B. Jobwechsel, Beförderung, Todesfall, …) und aufrechterhaltende Faktoren (z. B. Erwartungsängste und ständiges Grübeln im Bett).
Ziel der psychologischen Therapie ist unter anderen die Vermittlung von Strategien, mit deren Hilfe der/die PatientIn lernt, den eigenen Schlaf positiv zu beeinflussen, ohne langfristig auf die Einnahme von Medikamente angewiesen zu sein.
Hierzu gehören
- das Erlernen von Entspannungsmethoden (z. B. progressive Muskelentspannung, Meditation, Autogenes Training etc.), die das Einschlafen erleichtern.
- Bearbeitung der Hintergrundprobleme (z. B. Trauerarbeit im Falle einer Trennung, Perfektionismus, Versagensängste, Probleme im Job oder in der Familie, Beziehungsprobleme etc.).
- Kognitive Umstrukturierung: Ungünstige (dysfunktionalen) Gedanken/Katastrophengedanken (z. B. Angst, im Job zu versagen, nie mehr schlafen zu können, den Job zu verlieren, arbeitsunfähig zu werden, vom Partner verlassen zu werden etc.) werden identifiziert und durch konstruktive, realistische Gedanken ersetzt. Die Patientin lernt nach und nach, ihren Katastrophengedanken kritischer gegenüberzutreten.
- Achtsamkeitsmeditation hilft bei der Distanzierung von Grübeleien und Erwartungsängsten.
Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme:
Mag.a Julia Gheri
Bruckergasse 1
6060 Hall in Tirol
06508403502